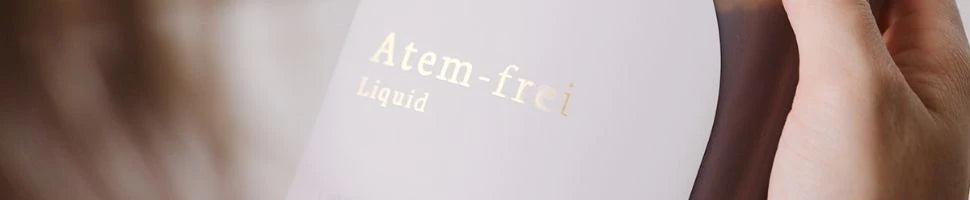
Lexikon
Futter
Tatsächlich zählt Kotwasser beim Pferd nicht als Pferdekrankheit, denn dieses "Auslaufen" ist wirklich ein Symptom für ein Verhältnis, mit dem das Tier psychisch oder physisch nicht klarkommt.
Es fließt, wenn im Darm des Tieres überschüssiges Wasser nicht ausreichend gebunden wird. Im Normalfall resorbiert der Dickdarm das freie Wasser, aber wenn dieser Prozess nicht vollständig arbeitet, bleibt als unschönes Ergebnis leider viel Kotwasser übrig.
Mehr zum Thema Kotwasser findest du in unserem Magazin.
Ob täglich trainierte Sportpferde, ein altes Pferd, die Zuchtstute oder das geherzte Freizeitpferd - alle müssen dauerhaft Zugang zu ausreichend Raufutter in Form von Heu bekommen. Diese Basisgrundlage ist ausschlaggebend für einen gut funktionierenden Verdauungstrakt und ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl. Denn wie Du sicher weißt, müssen Pferde beinahe kontinuierlich knabbern, um gesund zu bleiben.
Den sogenannten Erhaltungsbedarf (Überleben ohne Leistung) kannst Du allein durch hochwertiges Raufutter decken. Meist wird als Faustregel ca. 1,5 kg Heu auf 100 kg Lebendgewicht des Tieres angerechnet. Wird jedoch deutlich Arbeitsleistung erbracht, muss auf eine leistungsorientierte Pferdefütterung geachtet werden.
Heu ist weit mehr als nur getrocknetes Gras. Das Heu gehört zum Raufutter und stellt die Futtergrundlage des Pferdes. Es ist rohfaserreich, hat eine grobe Struktur und fördert die Speichelbildung und somit eine gesunde Verdauung. Heu enthält sehr viele wichtige Nährstoffe! Neben Energie, Eiweiß und Zucker auch die für die Verdauung unersetzliche Rohfaser. Ebenfalls enthalten sind Fette, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine.
Stroh kann als teilweiser Ersatz von Heu dienen. Vor allem bei Pferden, die abnehmen sollen oder die zu leichtem Übergewicht neigen. Aufgrund des geringen Nährstoffgehaltes und der geringen Verdaulichkeit dient Stroh hauptsächlich als Beschäftigung, aber auch um ein Sättigungsgefühl zu erreichen
Einzelfutter wie Hafer, Gerste, Mais, Weizenkleie und Müsli gehören in die Gruppe des Kraftfutter. Wie der Name uns schon vermuten lässt, führen diese Futtersorten dem Pferd unter anderem zusätzliche Energie zu.
Unterschiede in der Ernährung gibt es nicht nur bei uns Menschen. Auch bei der Pferdefütterung spielen unterschiedliche Faktoren mit, die entscheidend sind welche Futtermittel das Tier zu fressen bekommt. Während die Futtermenge davon abhängt wie Haltung und Pferdetypus konzipiert sind, zeigt sich das "was" zusätzlich kompliziert.
Fakt ist: Ob täglich trainierte Sportpferde, ein altes Pferd, die Zuchtstute oder das geherzte Freizeitpferd - alle müssen dauerhaft Zugang zu ausreichend Raufutter in Form von Heu bekommen. Diese Basisgrundlage ist ausschlaggebend für einen gut funktionierenden Verdauungstrakt und ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl. Denn wie Du sicher weißt, müssen Pferde beinahe kontinuierlich knabbern, um gesund zu bleiben.
Weitere Futtermittel können sein:
• Kraftfutter
• Zusatzfutter
• Saftfutter
• Heu- oder Luzernecobs
• Mineralfutter
• Öle
Als Basis dient also immer gutes Heu. Den Unterschied macht im Grunde das geleistete Pensum, die körperliche Verfassung (Alter, Erkrankung, Trächtigkeit etc...) und der Mehraufwand des jeweiligen Organismus aus. Wird das ergänzend zu den natürlichen Bedürfnissen der Pferde beachtet, steht einem zufriedenen Pferdeleben nichts im Weg.
Rohfaser sind schwer lösliche Kohlenhydrate, die im Dickdarm von Mikroben zersetzt werden. Es handelt sich um pflanzliche Bestandteile wie beispielsweise Cellulose.
Rohproteine befinden sich sowohl im Inneren der Pflanzenzellen als auch in der Gerüstsubstanz. Die Proteine, die sich innerhalb der Zelle befinden, werden von Enzymen im Dünndarm verarbeitet, wohingegen die schwerer verdaulichen Proteine aus der Zellwand erst im Dickdarm verdaut werden.
Rohfett wird ebenfalls im Dünndarm enzymatisch aufgespalten und in ungesättigte Fettsäuren umgewandelt.
Das gemähte Gras wird im Produktionsprozess auf einen Trockensubstanzgehalt von 25 bis 50 % getrocknet, stark verdichtet und luftdicht (anaerob) abgeschlossen gelagert. Dabei kommt es zu einer gewünschten Milchsäuregärung. Bei einem pH-Wert um 4 kommt die Gärung zum Stillstand, es stellt sich ein stabiles Gleichgewicht ein.
Es empfiehlt sich die Pferde über einen Zeitraum von ca. 3-4 Wochen langsam an die Grasfütterung zu gewöhnen. Hierfür eignet sich ein täglich ansteigendes Weideintervall oder eine allmählich mengenmäßig ansteigende Gras-fütterung im Stall.
Krankheiten
Mit einer Kolik beim Pferd ist keine spezifische Pferdekrankheit gemeint. Vielmehr ist Kolik ein Überbegriff für krampfartig auftretende Schmerzen in der Bauchhöhle des Tieres, welche vielfältigen Ursprungs sein können. Tatsächlich lässt sich dieses Krankheitsgeschehen sogar bis ins römische Reich zurückverfolgen, da das Pferd die Spezies Tier ist, welches am häufigsten darunter leidet.
Arthrose ist auch bei Pferden die häufigste aller Gelenkkrankheiten. Man sprich bei Arthrose beim Pferd von einer nicht-entzündliche Veränderung an einem oder auch an mehreren Gelenken. Es kommt zu einer Degeneration des Gelenkknorpels, wobei dieser erst löchrig und weich wird und dann mit der Zeit zunehmend verschwindet. Arthrose beim Pferd ist nicht heilbar, allerdings gibt es diverse Behandlungsmöglichkeiten und die Symptome können auf vielfache Weise gelindert werden, und so die Lebensqualität des betroffenen Pferdes verbessert.
(Inflammatory airway disease) = entzündliche Atemwegserkrankung. Bei der Atemwegserkrankung IAD werden als Ursachen allergische Prozesse, Immunschwäche sowie Infektionen durch Viren beschrieben. Häufig sind sogar junge Pferde betroffen. Der Pferdehusten zeigt sich hauptsächlich bei Belastung und kann einen enormen Leistungsabfall zufolge haben. Bei IAD-Pferden ist die Atmung meist normal in Ruhe. Es gibt jedoch Hoffnung, denn die Tiere können wieder vollständig gesunden bei dementsprechender Behandlung.
Übers Pferd
Auch unser Partner Pferd ist auf den Wechsel der Jahreszeiten vorbereitet und wechselt zweimal im Jahr das Haupthaar. Das ist natürlich anstrengend, für dich, da du dein Pferd von einem enormen Haarhaufen befreien musst, aber vor allem auch für dein Pferd, denn das gesamte Immunsystem muss mitarbeiten, um von der Sommer- auf die Wintergarderobe zu wechseln und umgekehrt. In diesem Fall ist es wichtig, dass du dein Pferd dabei unterstützt und dafür Sorge trägst, dass es gut und gesund den Fellwechsel übersteht.
Das größte Organ des Pferdes ist die Haut! Ja richtig gelesen – Die Haut ist ein wahrer Allrounder denn sie schützt den Körper vor äußeren Einflüssen, leitet Reize weiter, ist außerdem für die Wärmeregulation und für die Immunabwehr zuständig. Es ist also sehr wichtig für den Organismus des Pferdes, dass die Haut und das Haarkleid intakt sind.
Eine gesunde Lungenfunktion ist für unseren Partner Pferd sehr wichtig. Leider gibt es aber tatsächlich doch sehr viele Reitpferde, die gerade von Atemwegserkrankungen wie ROA oder IAD betroffen sind. Daher sollte Husten beim Pferd beim Pferdebesitzer sofort alle Alarmglocken auslösen. Hier ist schneller Handlungsbedarf gefragt, damit es nicht zu einer chronischen Bronchitis kommt.
RAO ist "umfangreicher" als IAD. Die Schleimhäute der betroffen Pferde schwellen stark an und Hustenkrämpfe versuchen den zähen Schleim, der sich immer zu bildet, loszuwerden. Die Atmung ist deutlich erschwert. Selbst im Ruhezustand ist eine erhöhte Atemfrequenz messbar.
Behandlungen
Hierbei wird die Beschaffenheit der Schleimhaut und das gebildete Sekret genauer bestimmt. Der Veterinär kann zudem Proben entnehmen und diese zur Überprüfung ins Labor senden, um bessere Einsicht in eine mögliche Lungenerkrankung (z. B. die chronische Bronchitis) zu bekommen und wie er weiterhin behandeln muss.
Das Inhalieren hat sich bereits in der Humanmedizin als sehr hilfreich erwiesen und zeigt rasch eine Linderung bei Atemwegserkrankungen. Eine chronische Bronchitis lässt sich damit gut eindämmen. Aber nicht nur das COPD Pferd profitiert vom Inhalieren. Jedem "Stallpferd" tut diese Behandlung gut. Oft kann das Gerät beim Hersteller oder auch bei deinem Tierarzt für einen bestimmten Zeitraum ausgeliehen werden. Kleinere, manuelle Geräte finden sich bereits käuflich im Fachhandel.
Diese wird auch mobil angeboten. Ein speziell umgebauter Pferdeanhänger verströmt wie ein riesiger Inhalator dem Pferd salzige Meerluft entgegen. Du musst demnach Dein Pferd nicht aufwendig zur Klinik fahren. Das kann praktisch vor Ort geschehen. Das ist Inhalieren in stattlicher Größenordnung!
Noch Fragen?
Sende uns gern eine Mail mit deiner Frage und wir beantworten diese gerne!
